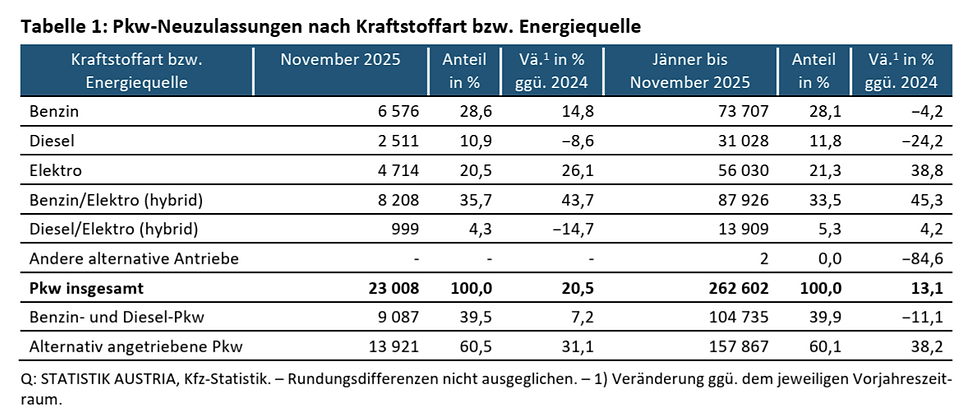Stromkosten-Explosion: Sind E-Autos Schuld?
- Philipp Lumetsberger

- 25. Feb. 2022
- 5 Min. Lesezeit
Mehr Elektroautos auf den Straßen führen zwangsläufig zu einem höheren Strombedarf. Das dieser gedeckt werden kann, daran besteht unter Experten kein Zweifel. Doch wie wirkt sich dieser Mehrbedarf in Zukunft auf die Strompreise aus? Wir sind dieser Frage nachgegangen!
Je mehr rein elektrisch betriebene Autos über die Straßen rollen, umso mehr Strom wird benötigt. Schätzungen zufolge wird der Marktanteil von E-Autos in Deutschland zur Mitte des Jahrhunderts bei 40 Prozent liegen. Daher ist es nicht weiter verwunderlich, dass sich immer mehr Menschen die Frage stellen wo der dafür notwendige Strom herkommen soll und ob die Stromkosten aufgrund von Millionen Elektroautos in ungeahnte Höhen schnellen werden.
Konstanter Preisanstieg
Tatsache ist, dass der Strompreis hierzulande schon seit Jahren kontinuierlich ansteigt. In den letzten 20 Jahren hat sich der Preis aufgrund von Steuern, Umlagen und sonstiger Abgaben in etwa verdreifacht.
Im internationalen Vergleich ist die Bundesrepublik bei den Stromkosten im Spitzenfeld. Für die Preisgestaltung sind vor allem folgende Faktoren ausschlaggebend: Stromeinkauf, Service, Vertrieb, Netzentgelte, Steuern, Abgaben und Umlagen. Die drei erstgenannten beeinflussen den Strompreis zu 24 Prozent und können von den einzelnen Energiekonzernen beeinflusst werden. Die Netzentgelte, die einen Anteil von 25 Prozent ausmachen, sind wiederum gesetzlich reguliert und werden über die Strompreise direkt an die Kunden weitergegeben. Der Rest setzt sich aus den staatlich festgelegten Steuern, Abgaben und Umlagen zusammen und erhöht den Preis um 51 Prozent.
Im Jahr 2021 lag der durchschnittliche Strompreis in Deutschland im Durchschnitt bei 31,9 Cent. In Österreich beispielsweise kostete eine Kilowattstunde Strom durchschnittlich rund 22,2 Cent. Noch günstiger war dieser in den vergangen 12 Monaten in Norwegen mit einem Preis von 18,3 Cent.
Der Strombedarf steigt
Das Bundeswirtschaftsministerium hat Mitte November 2021 eine Prognose zur Entwicklung des Stromverbrauchs bis zum Jahr 2030 präsentiert. Demnach soll bis zum Beginn der neuen Dekade der Verbrauch um 11 Prozent im Vergleich zu 2018 und auf eine Gesamtmenge von 658 Terrawattstunden steigen. Das Ministerium geht bei seinen Berechnungen von 16 Millionen E-Autos und 2,2 Millionen Plug-in-Hybriden zum Jahr 2030 aus.
Als Hauptverursacher für den Verbrauchsanstieg gilt laut Ministerium zweifelsfrei der Verkehrssektor. Insbesondere die Elektromobilität im Straßenverkehr sorgt für einen Anstieg um 68 Terrawattstunden. Davon entfallen rund 44 TWh auf Pkw, 7 TWh auf leichte Nutzfahrzeuge und 17 TWh auf schwere Nutzfahrzeuge. Zusätzlich sorgen der Schienenverkehr, die Herstellung von Wasserstoff, Wärmepumpen, Batteriefabriken und Rechenzentren für einen erhöhten Energieverbrauch. Eine gesteigerte Energieffizienz und ein reduzierter Eigenverbrauch von Kraftwerken sollen hingegen laut den Prognosen sinken und so dem Anstieg entgegenwirken.
Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) wiederum geht von einem noch höheren Stromverbrauch im Jahr 2030 aus. Laut dem Verband wird dieser rund 700 Terrawattstunden betragen. Aus Sicht des BDEW ist zudem ein höherer Anteil an Ökostrom von etwa 70 Prozent bis 2030 erforderlich, damit trotz der Mobilitätswende auch die Klimaziele erreicht werden können. Hierfür ist nicht nur ein massiver Ausbau des Stromnetzes notwendig, sondern auch der Bau von Windkraftanlagen an Land.
Auch wenn der Strombedarf ohne Zweifel in den nächsten Jahrzehnten kontinuierlich steigt, wird der Mehrbedarf nur zum Teil von Elektroautos verursacht. Wesentlich mehr Elektrizität wird unter anderem von der Industrie und durch den Heizbedarf in Gebäuden benötigt werden. Das der Strombedarf von rein elektrisch betriebenen Fahrzeugen nicht ins Unermessliche steigen wird, liegt laut ADAC daran, dass Elektroautos im Vergleich zu Verbrennern effizienter sind. Erstere holen demnach mehr aus der benötigten Energie heraus. Dementsprechend gering fällt dadurch die Auswirkung auf den Stromverbrauch und die systemweite Spitzenlast aus.
Ein Blick zum Nachbarn
Doch wie sieht die Situation in der Alpenrepublik aus? Wenn in Österreich alle PKW-Besitzer auf ein Elektroauto umsteigen würden, steigt der gesamte Stromverbrauch um lediglich 14 Prozent. Umgerechnet entspricht dieser Prozentsatz einem Wert von rund 10 Terawattstunden.
Der österreichische Strompreis besteht zu 36,5 Prozent aus Steuern und Abgaben in Form von fünf verschiedenen Komponenten, darunter etwa auch Ökostromförderkosten in Höhe von 8,4 Prozent. Einen relativ großen Anteil machen auch die Netzkosten aus. Die Kosten für die reine Energie machen 27,9 Prozent des Gesamtpreises aus.
Der jährliche Stromverbrauch in Österreich dürfte Prognosen zufolge bis 2030 um rund ein Drittel auf etwa 88 Terrawattstunden ansteigen. Im Rahmen der von der Politik beschlossenen Klima- und Energiestrategie soll bis zum Beginn des nächsten Jahrzehnts der in Österreich produzierte Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energieträgern stammen.
Ambitionierte Ziele der Alpenrepublik

In Österreich soll der Stromverbrauch Berechnungen zufolge bis zum Beginn der nächsten Dekade um etwa ein Drittel auf rund 88 Terrawattstunden ansteigen.
Die österreichische Politik hat das ehrgeizige Ziel ausgegeben, dass bis 2030 die Stromproduktion ausschließlich durch den Einsatz erneuerbarer Energien erfolgen soll. Knapp 83 Terrawattstunden - und damit der Großteil des prognostizierten Stromverbrauchs - sollen zu diesem Zeitpunkt ökologisch produziert werden. Ob dieses Vorhaben auch tatsächlich gelingt, ist fraglich.
Smarte Ladestationen als wichtiger Faktor
Damit der Energiebedarf uneingeschränkt bedient werden kann, spielt neben dem Ausbau von erneuerbaren Energiequellen auch die Nutzung smarter Ladestationen im Zusammenspiel mit einem intelligenten Stromnetz eine zentrale Rolle.
So können Ladezeiten automatisiert in einen Zeitraum gelegt werden, in dem die Spitzenlast des Stromnetzes möglichst gering ist. Statt alle E-Autos direkt nach Feierabend in den frühen Abendstunden an der privaten Ladestation zu Hause aufzuladen, laden die intelligenten Wallboxen das E-Fahrzeug erst dann, wenn sie vom Smart Grid, oder auch intelligentes Stromnetz genannt, entsprechend angesteuert werden. Beispielsweise zwischen 22 und 4 Uhr morgens, wenn es keinen erhöhten Strombedarf durch Kochen, Streaming und ähnliche Aktivitäten in den Haushalten gibt. Laut Experten lässt sich so die Spitzenlaststeigerung, die sich durch den Ladebedarf der E-Autos ergibt, um bis zu 80 Prozent verringern. Auch dadurch werden Stromengpässe verhindert.
Das intelligente Stromnetz steuert das immer komplexer werdende Energiesystem, das nicht mehr nur aus zentralen Kraftwerken,
Windkraftanlagen oder Solarparks gespeist wird, sondern auch dezentral von privaten Energieerzeugern. Sie sind ein wichtiger Teil der Energiewende und produzieren beispielsweise mittels Photovoltaikanlagen ihren eigenen Strom. Der überschüssige Strom wird dabei entweder gespeichert oder ins Netz eingespeist. So ist immer ausreichend Energie vorhanden, selbst wenn die Stromproduktion aus regenerativen Quellen wie Sonne und Wind aufgrund des Wetters schwankt. Anhand von Echtzeit-Marktdaten zu Angebot und Nachfrage sowie Berechnungen über den erwarteten Bedarf und die künftige Erzeugung verteilt das Intelligente Stromnetz die Energie vorausschauend und effizient auf alle Kunden.

Interessantes Studienergebnis
Wie sich die Strompreise aufgrund einer durch Elektroautos verursachten höheren Nachfrage entwickeln, hat sich die Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie (kurz: IEG) im Rahmen einer Studie genauer angesehen. Diese kam zu dem Ergebnis, dass in einem bestimmten Netzgebiet ein Anteil von 30 Prozent privat genutzter Elektroautos die Strompreise um bis zu 3,5 Prozent senken könnte. Laut den Studienautoren sind zwei Faktoren ausschlaggebend, damit die Strompreise sinken. Durch ein Aufladen der Elektrofahrzeuge während der Nachtstunden kann die Auslastung des Stromnetzes effizienter gestaltet werden. Dadurch verringere sich der Bedarf für den Netzausbau und die Netzentgelte, die für die Nutzung des Stromnetzes entrichtet werden müssen, können hierdurch sinken.
Außerdem könnte laut IEG die Batteriekapazität von E-Autos auch dafür verwendet werden, die Energie aus erneuerbaren Quellen zu speichern und zu einem späteren Zeitpunkt zu verwenden. Dadurch sinken nicht nur die CO2-Emissionen, sondern auch die Beschaffungskosten am Strommarkt.
Als essenziell sehen die Studienautoren für einen sinkenden Strompreis trotz einer Vielzahl an elektrisch betriebenen Fahrzeugen auf den Straßen ein fixes Zeitfenster, an dem die Autos aufgeladen werden sollen.
E-Autos gelten nicht als Hauptpreistreiber
Wie sich die Strompreise in Zukunft tatsächlich entwickeln werden, kann man zum jetzigen Zeitpunkt natürlich nicht vorhersagen. Zahlreiche Mobilitätsexperten gehen jedoch davon aus, dass Elektroautos nicht für explodierende Preise sorgen werden. Schließlich ist der Verkehrssektor nur einer von mehreren Bereichen, die in Zukunft mehr Energie benötigen werden. Daher können elektrisch betriebene Fahrzeuge nicht als alleinige Preistreiber betrachtet werden. Auch wenn es im ersten Moment etwas ungewöhnlich klingt, könnten Elektroautos durch eine effizientere Netzauslastung einen positiven Effekt auf den Strompreis haben.